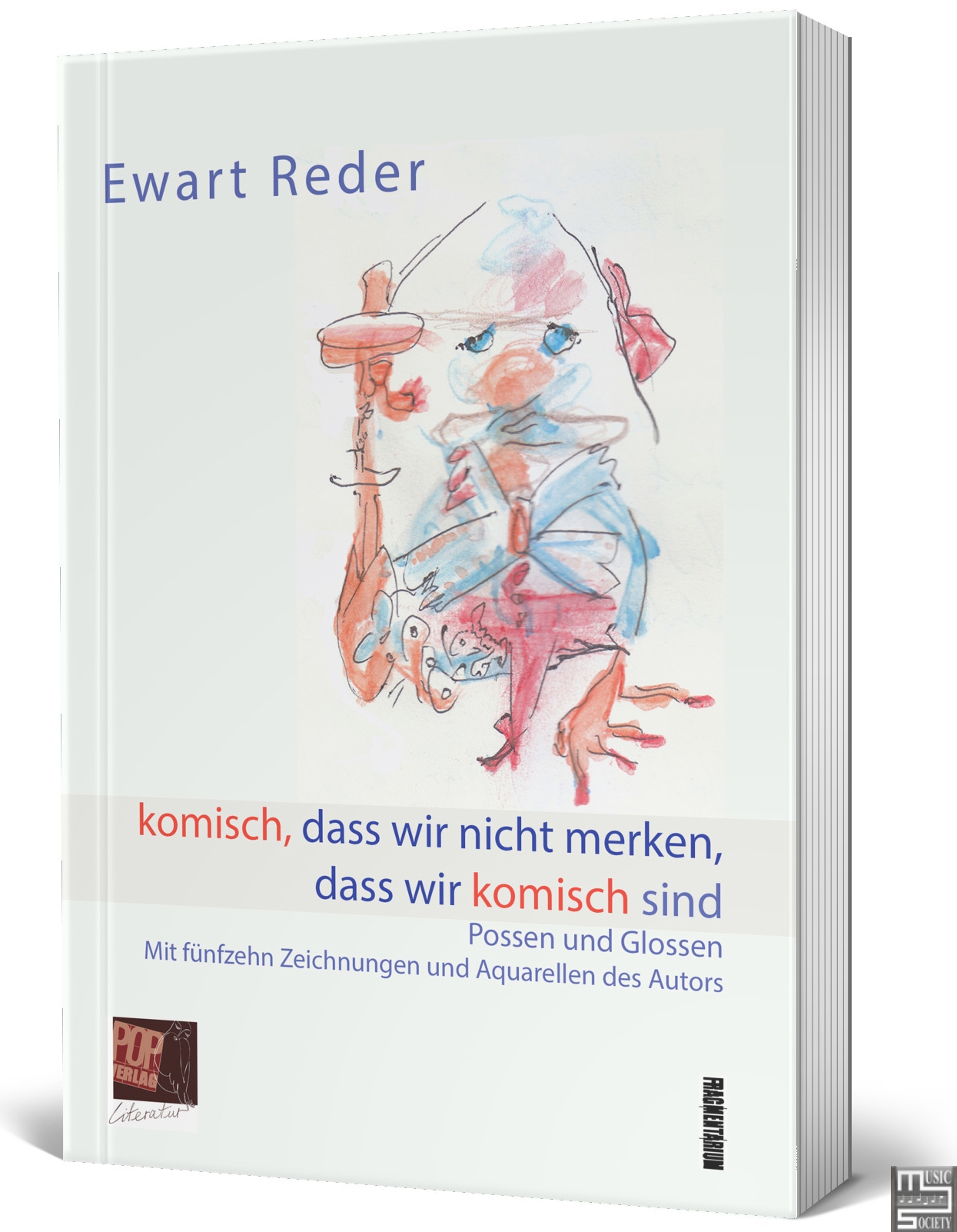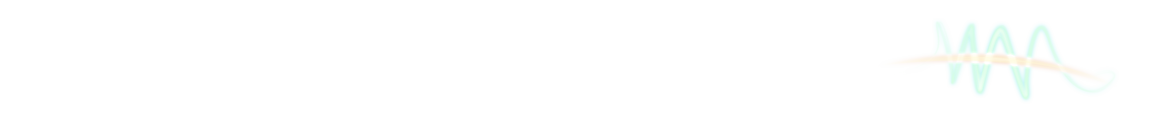© Ewart Reder
Im Haushalt tue ich, was ich kann. Was zugegeben nicht viel ist. Es geht aber nicht nur um das Was, finde ich, wichtig ist auch das Wie eines Tuns. Wenn ich zwei Adjektive nennen sollte, um die Art und Weise meiner Haushaltstätigkeit zu beschreiben, wären es „zuverlässig“ und „freudvoll“. Zuverlässig, weil ich, wenn ich das auch nicht mehr machen würde, als faul gelten könnte. Freudvoll, weil ich mich durch mein Tun minutenlang unangreifbar fühle. Aber ich sehe grad, die Spülmaschine möchte was zu dem Thema sagen:
Na ja, mich würde er eh im nächsten Satz erwähnen. Bin ich es doch, worauf seine Haushaltstätigkeit sich im Grunde beschränkt. Genauer eine Hälfte von mir: mich ausräumen. Wohin Geschirr und Besteck gehören, hat er auf rätselhafte Weise herausgefunden. Okay, nicht dass da nicht anschließend jedes Mal die obligaten Siebensachen noch rumliegen würden, die entweder angeblich neu oder deren Plätze angeblich seit je ungeklärt seien. Oder dass die Chefin nicht „zuverlässig“ ihre mindestens drei Ablageüberraschungen erleben würde jedes Mal. Aber gut, sehen wir es mal nicht so eng. Das macht er und das kriegt er irgendwie hin. Mich einräumen hingegen will die Chefin lieber selbst. Das mache er, wenn er es macht, auf so charakteristische Weise falsch, sagt sie, dass sie ihn dabei jedes Mal wieder kennenlerne. Was offenbar nicht ihre vorrangige Absicht ist. Dabei habe er doch seinerzeit, sagt die Chefin, das Auto, als man noch eins gefahren sei, so vorzüglich beladen jedes Mal vor der Urlaubsreise.
Ein Autokofferraum, wenn ich das einwenden darf, hat auch keine drei unterschiedlich hohen Fahrkörbe mit Features wie Klappstachelreihen für Teller, Tassenetageren, gezackten Kappenleisten mit Gläsersymbol und nicht zu vergessen Korbrollen, weil sonst die Dinger nicht fahren würden. In einen Kofferraum stellt man Sachen mehr oder weniger einfach rein. Wie übrigens auch in einen Geschirrschrank oder ein Tassenregal. Darüber hätte die Chefin mal nachdenken können: Warum kriegt er das hin? Was genau ist beim Mich-Einräumen das Kriterium, das er mit seinem Kenntnisstand und seinen motorisch-kognitiven Fähigkeiten unweigerlich reißen muss? Es hat etwas mit den Vorgaben zu tun, die ich für die Platzierung von Gegenständen in mir mache. Da kann man nicht einfach so angewuchtet kommen und irgendwelche Koffer noch im Laufschritt mit Schwung … Neee. – – – Da braucht es ein ausgeruhtes Auge. Einen kühlen Kopf. Jahrzehnte Erfahrung. Räumliches Vorstellungsvermögen gepaart mit im Laufe der Jahre unverrückbar gewordenen Grundsätzen, einer festen Reihen- und Rangfolge der zu berücksichtigenden Objekte sowie zu guter Letzt das berühmte Fingerspitzengefühl. Das fehlt den Männern ja so bemitleidenswert generell.
An der Stelle mache ich einen Perspektivwechsel. Bis hierher habe ich ausgeführt, wie sich die Dinge aus Sicht der Chefin ausnehmen und wie ich sie mit ihr gewöhnlich bespreche. Das spiegeln wir jetzt mal. Mich-Einräumen aus Sicht der männlichen Hilfskraft. Ganz einfach: Was drin ist, steht nicht mehr rum. Was zu spät kommt, bleibt draußen und fährt beim nächsten Mal mit. Merken Sie was? Die zwei Perspektiven sind miteinander prinzipiell unvereinbar. Das ist Krieg bis zum letzten Teelöffel ohne jede Chance auf eine Verhandlungslösung. Schade nur, dass die beiden das weder kapieren noch irgendeine Neigung entwickeln, ihre Unterschiedlichkeit als Reichtum zu erleben. Auch schade übrigens, dass sie entschiedene Gegner von smart home sind. Für mich wäre smart home die einzige Chance, mich über meine Beobachtungen mit einem intelligenten Gegenüber auszutauschen. Und für die beiden wäre die Chance noch größer: dass nämlich ein Konsilium aus kompetenten Küchen-, Büro-, Unterhaltungs-, Sport- und Erotikgeräten ihre Probleme besprechen und auf dieser Grundlage eine vernetzte Paartherapie entwickeln sowie durchführen könnte.