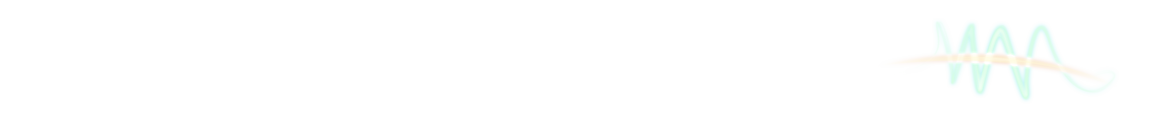Wieder ein Hotel – und wieder in Potsdam! Weil CORRECTIV keine Zeit hat, ist die Wahrheitsdrohne hingeflogen und zeichnet alles auf, durchs offene Fenster, im Auftrag von Fox-News, wie sie frech behauptet. Sogar ein Interview wird ihr gegeben, vom Anführer einer Geheimorganisation, die die „Premigration“ von Millionen Deutschen nach Amerika vorbereitet. „Na ja, der Redakteur hätte mal kommen können“, mault der Mann, „aber meinetwegen. Was wollen Sie wissen?“ Die Drohne wird zum ersten Mal gesiezt und verhaspelt sich prompt bei der ersten Frage:
Herr Schmerz, wawawas bebedeutet „Premigration“?
Das Wort habe ich erfunden. Es verbindet die Worte premium und gratia. Ich sage, dass nur die Besten mitkommen, und zwar von Meinen Gnaden. Die Vorsilbe pre deutet überdies an, dass wir dem Projekt der Konkurrenz zuvorkommen: der Remigration. Sehen Sie, Millionen Menschen vertreiben ist anstrengend. Ich mache das nicht. Stattdessen wandern wir selber aus und lassen die Wähler der Konkurrenz mit den Ausländern allein.
Aber Sie sind doch der nächste Kanzler.
Falsch. Ich tue zwar so, als würde ich der nächste Kanzler. In Wahrheit bedeutet aber ein Kreuz für meine Partei auf dem Wahlzettel das Ticket für die Überfahrt. Ich habe mit der Bundeswahlleiterin gesprochen, die Zettel werden gesammelt und mir ausgehändigt. Wer die rechte untere Ecke geknickt und in der Wahlkabine ein Selfie gemacht hat, kommt mit.
Und warum wollen Sie alle weg?
Der große Austausch ist nicht mehr aufzuhalten. Die Konkurrenz streut dem Wähler Sand in die Augen, aber wir wissen: Die Deutschen sollen die Sklaven der Ausländer werden, und das machen wir nicht mit. Die werden schön gucken, die Ausländer.
Sie gucken aber auch ganz schön. Ihr Blick kann einem ja Angst machen.
Richtig. Man nennt mich den BlackRock-Vampir und da ist was dran. Ich entstamme einem alten sauerländischen Vampirgeschlecht. Mein Blick hat die Kraft, alles Deutsche anzusaugen. Ist es angesaugt, nehme ich es mit nach Amerika und weg ist das komplette Restdeutsche aus dem so höchstens noch genannten „Deutschland“.
Warum denn nach Amerika?
Wir folgen da einer Prophetie, die vor hundertfünfzig Jahren ausgesprochen wurde. Damals war es wie heute, der ehrliche Deutsche hatte in seiner Heimat keine Chance. Ihm wurde gesagt: Dein Dorf wird abgeschafft und du musst in einer Stadt leben. Die Bestürzung war groß, keiner wusste, was eine Stadt ist. Man wusste, dass da Zeitungen und Bücher gedruckt wurden, die keiner lesen konnte. Man wollte weit weg sein, wenn es passierte. In der Stunde der Not stand in einem pfälzischen Dorf ein Prophet auf und kündete: „Im Westen, hinter dem großen Wasser, liegt ein Land, in dem es keine Druckerzeugnisse und Städte, sondern nur niedliche kleine Dörfer gibt. In das Land müsst ihr ziehen und hundertfünfzig Jahre warten. Dann wird ein Präsident aufstehen – und nach gestohlenen vier Jahren gleich noch mal aufstehen – , der sich eurer annimmt wie ein Bruder. Euer Bruder wird er sein, weil er von einem von euch, die ihr heute in die Ferne zieht, abstammen wird.“ So sprach der Prophet, den man bald den pfälzischen Marcus Garvey nannte („Exodus! Movement of de Pälzer“). Wobei er mit bürgerlichem Namen Dumbold Trampel hieß.
Ach so, Sie meinen den Trump.
Richtig. Das ist der Enkel. In unseren Tagen erfüllt sich die Prophetie. Ich habe mit dem Präsidenten gesprochen, deutsche Einwanderer sind willkommen. Wenn sie die Schnauze halten und amerikanische Autos und Grenzzäune bauen, vergisst er die Sache mit dem Weltkrieg und den Whiskeyzöllen.
War Trumps Großvater nicht Friseur? Von einem Propheten habe ich noch nie gelesen?
Friseur, Prophet – wo ist der Unterschied? Schauen Sie sich die gelben Haare an. Noch Fragen?
Ja, die hier: Der Großvater wurde vom Deutschen Reich ausgebürgert, als Fahnenflüchtling. Sie sind Fahnenjunker, Herr Schmerz. Ist das dasselbe?
Im Gegenteil. Ich wäre fast Reserveoffizier geworden, hab mir dann aber das Knie wehgetan an der Panzerluke. Die Waffen sind zu klein hier. Wie die Boni. (Lacht)
Noch eine Frage: Werden Ihre Wähler Ihnen auch folgen – in ein unbekanntes Land, so weit weg?
Sie sprechen da ein Problem an, das uns Kopfzerbrechen bereitet hat. Der Prophet drückte sich in der Sprache seiner Zeit aus. Aber seine Jünger glauben ihm aufs Wort. Gesagt hat er: „Wenn ihr den Rauch des schwimmenden Hauses aus dem Tal des großen Flusses aufsteigen seht, dann wallet hurtig hernieder von den Weinbergen ans Ufer und rein in das Schwimmehaus!“ Sie sehen das Problem vor sich. Aber es ist gelöst! Wir lassen tatschlich Raddampfer den Rhein runterfahren nach Rotterdam. Ratter ratter! Die werden mit deutscher Steinkohle betrieben, die wir über die Jahre gesammelt haben. Wo war die versteckt? fragen Sie sich. Antwort: Im Kyffhäuser. Alle deutschen Träume auf einmal werden wahr in meiner Gestalt.
Und ihr Flugzeug?
Ist schon drüben. Mit meinem Kaminpfleger, den hab ich letzte Woche rübergeflogen.
Kaminpfleger? Was ist das denn?
Das ist ein Afrodeutscher, der macht Ihnen ein richtiges Lagerfeuer in Ihrem Wohnzimmer. So was hat der Präsident noch nicht gesehen. Bei mir zieht das immer nicht richtig, darum beschäftige ich einen Migranten in meinem Haushalt.
Und wie wird das mit Trump und Ihnen auf dem Golfplatz? Haben Sie geübt?
Ach wissen Sie, ich seh den Ball nicht mehr richtig. Meine Füße sind so weit weg. Wegen meiner Steifheit eigne ich mich immerhin zu dem, was ich in der Schule war: zum Schläger. In den richtigen Händen hab ich richtig Spaß. Olaf Scholz eignet sich nur als Ball.
Sie und Trump – sehen wir da einer echten Männerfreundschaft entgegen?
Definitiv. Im Puff werde ich eher auf die Anziehsachen aufpassen. Aber die Kamingespräche über Derivate und Krypto werden bestimmt schön.
Am Ende des Tages haben Sie dann aber nichts regiert, nirgendwo. Tut das nicht weh?
Nein. Die Reserve ist mein Ding. Wenn Sie in ein großes Land einmarschieren, entscheidet die Reserve über den Sieg. Aus Zeitgründen. Da wird mein Freund an mir und meinen / seinen Landsleuten noch viel Freude haben. Die Last Americans (L.A.) – so heißt unsere Geheimorganisation – sind einsatzbereit bis zum letzten Schulbub.
Geheimorganisation? Dürfen Sie dann überhaupt mit mir reden?
Ich rede allgemein recht gern. Das ist so eine Art Hobby von mir. Als Politiker habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht.